Ulrike Edschmid
Das Verschwinden des Philip S.
Am Anfang: der Tod auf den Zeitungsbildern - ein erschossener Polizist, einige Meter entfernt ein junger Mann in schwarzer Lederjacke, niedergestreckt, als er flüchtete, auf einem Parkplatz in Köln 1975. Wer zuerst geschossen hat und was auf diesem Parkplatz wirklich geschah, wird in den Prozessen der bleiernen Zeit der 70er Jahre nicht aufzuklären sein.
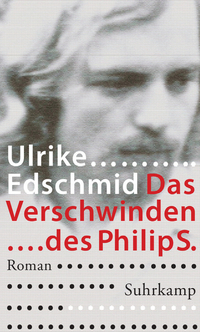 Mit Frau und Kind
Mit Frau und Kind
Ulrike Edschmid lernte den jungen Mann aus der Schweiz, der damals noch Anzüge trug, 1967 kennen und lebte mit ihm und ihrem kleinen Sohn in Berlin, und in ihrem Roman versucht sie, den toten Philip S. aus den Zeitungsfotos heraufzubeschwören. Er war nach Berlin gekommen, um an der Filmhochschule zu studieren, und als 1968 die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg eskalierten, drehte er seinen einzigen Film, 'Der einsame Wanderer' – die einzige sichtbare Spur, die zu ihm führen könnte, einem Träumer, beeindruckt von Andy Warhol und Jean Luc Godard und von der Möglichkeit, mit Frau und Kind zu leben.
Suche nach Antworten
Liebevoll ist Ulrike Edschmids langer Blick zurück, der der Erinnerung genaue Bilder zu entreißen sucht, und er ist zugleich voller Trauer, im Wissen darum, dass der Weg des Zürichers Werner Philip Sauber in den bewaffneten Untergrund unaufhaltsam war. Dass sie dennoch nach dem Warum fragt und im Aufbegehren einer ganzen Generation nach Antworten sucht, macht ihr Buch so verstörend. Denn die Akteure sind im Rentenalter und ihre Erinnerungen durch wieder und wieder ausgeschlachtete Bilder verzerrt und oft durch Heldengeschichten oder ideologische Rechtfertigungen überlagert. Der Tod von Benno Ohnesorg, das Attentat auf Rudi Dutschke, die Straßenschlachten mit der Polizei, die Institutsbesetzungen – für etliche waren das Stationen auf dem Weg aus der linksextremen Szene in einen Untergrund, der wiederum mit Bildern von Che Guevara und anderen ausstaffiert und heroisiert wurde.
Gegen Ende des Sommers legt er mir die Kamera, die ihm einmal alles bedeutet hat, als Geschenk in den Schoß. Er hat sie nur noch einmal benutzt, als er anfing, sich mit dem Fälschen von Pässen zu beschäftigen. Ich konnte in diesem Augenblick auf der Terrasse nicht ahnen, dass er sich bereits freizumachen begann, lautlos und unauffällig, zuerst von den Dingen und dann, später, von den Menschen.
Demonstrative Lösungen
Warum aber endete dieser Weg im Tod oder im Gefängnis, während andere in Ministerämter schlüpften, Rundfunkredakteure wurden, Theaterleiter oder Lehrer? Gab der Rauswurf aus der Universität, der Filmhochschule den Ausschlag? Trugen die Hausdurchsuchungen, ungerechtfertigten Verhaftungen, die öffentliche und private Hysterie dazu bei, die dünne rote Linie zu überschreiten und sich ein widerspruchsfreies, entschiedenes Leben zu wünschen?
Ulrike Edschmid vermeidet vordergründige Antworten, hat aber die gefährliche Verlockung der Radikalität nicht vergessen und weiß, wie stark sie in diesen frühen 70er Jahren gewirkt hat. Und die Geschichte selbst, die deutsche wie die der Kolonisierten und Unterdrückten, legte für viele nahe, auf demonstrative Lösungen zu setzen.
Verborgene Ziele
Akribisch beschreibt die Autorin, wie ihr Freund beginnt, seine Vergangenheit auszulöschen, wie er nach der ersten Festnahme sein Leben durch einen einzigen heroischen Auftrag zu ersetzen sucht, täglich fremder wird, sich vom gemeinsamen Alltag ablöst, verborgenen Zielen folgend. Eine Antwort auf das 'Warum' findet Ulrike Edschmid auch heute nicht, und sie fasst den Schmerz über die letzte Begegnung, die Aussichtslosigkeit einer Rückkehr in eine unpathetische, genaue und sehr berührende Sprache.
Alle Erklärungsversuche werfen ein Netz über ihn, das ihn gefangen hält und gegen das er sich nicht mehr wehren kann…Wir können nicht mehr eintauchen in die Erinnerung an das, was mal unser gemeinsames Leben war. Die Erinnerung ist Sperrgebiet, weil er jetzt ein anderer ist, einer, der von nichts weiß, für den es die Wohnung an den Bahngleisen nicht geben darf und nicht den Tag, als er bei mir blieb, um, wie er mich damals spüren ließ, nie mehr wegzugehen.
Weggegangen ist Philip S. für immer, und sein Sterben auf dem Parkplatz wurde millionenfach gezeigt. Zuweilen glaubte die Autorin, ihn zu sehen, in der Menge, auf der Straße, und mit ihrer berührenden Totenklage macht sie die Erinnerung an ihn zum Zeugnis einer ganzen Generation.
(Lore Kleinert)
Ulrike Edschmid "Das Verschwinden des Philip S."
Suhrkamp, März 2013, 157 Seiten, 15.95 Euro
