Romain Gary
Europäische Erziehung
„Diese europäische Erziehung … bedeutet nur: Sie erschießen deinen Vater, du selbst tötest jemanden im Namen einer Sache, du verreckst vor Hunger, eine Stadt wird in Schutt und Asche gelegt. Ich sage dir, wir sind durch eine gute Schule gegangen, du und ich, wir haben unsere Erziehung abbekommen.“
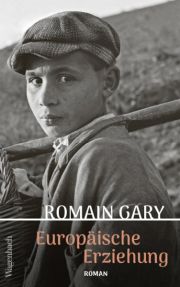 Säuberungsaktion
Säuberungsaktion
Als Doktor Twardowski seinen Sohn Janek im Wald versteckt, hat die Schlacht um Stalingrad, die die Wende im Krieg der Deutschen gegen die halbe Welt bringen sollte, gerade begonnen. Er rät seinem Sohn, sich vor den Menschen zu hüten, und nach zwei Nächten kommt er nicht wieder, denn er fällt einer sogenannten Säuberungsaktion der Deutschen zum Opfer. Nach Kriegsende ist Janek erwachsen, blickt als Leutnant der polnischen Armee auf die Jahre im Wald zurück, ist Vater eines kleinen Jungen, und er wird Musik studieren.
Romain Gary erzählt, wie sich der Junge zu den ‚Waldlern‘ rettete, einer Gruppe von Partisanen aus Polen, Litauern, Ukrainern, Juden, für die er Botendienste übernimmt. Pech war Jurastudent, Tadek Chmura und seine Freundin studierten Geschichte, Dobranski schreibt ein Buch, das ‚Europäische Erziehung‘ heißen soll: „Tadek Chmura hat mir den Titel vorgeschlagen. Das hat er bestimmt ironisch gemeint. Die Europäische Erziehung, für ihn heißt das: Bomben, Massaker, erschossene Geiseln, Menschen, die in Höhlen leben wie Tiere.“ Doch der Überlebenskampf der Gruppe, und vieler anderer, die ebenso radikal gegen die deutschen Besatzer kämpfen, erscheint in diesem Roman als vielschichtiger und kreist vor allem um die Frage, wie es unter den elendesten Bedingungen möglich bleibt, sich Menschlichkeit zu bewahren. Dobranski spielt für den fünfzehnjährigen Janek dabei eine besondere Rolle, denn ihm gelingt es bis zum Ende, an den Sieg der Kultur zu glauben:
„Die Wahrheit ist: Es gibt Momente in der Geschichte, Momente wie diesen, in denen der Mensch ein Versteck braucht, eine Zuflucht, um nicht zu verzweifeln, um nicht den Glauben zu verlieren, seinen Überlebenswillen. Und diese Zuflucht kann alles sein, manchmal braucht es nur ein Lied, ein Gedicht, ein Musikstück oder ein Buch.“
Krieg erst lernen
Als leises Gegengewicht gegen die Notwendigkeit des Tötens zieht sich diese Gegenposition zum Zynismus und der Verhärtung der Seelen durch Garys Roman. Die Akteure selbst müssen den Krieg erst lernen, müssen Hunger und extreme Kälte aushalten, und die wenigsten hatten das Handwerk des Krieges erlernt. Romain Gary erkundet ihre Geschichte, ihre Vergangenheit, immer dezent und in schönen, schwingenden Sätzen, die an Sergiusz Piasecki erinnern, einen anderen, vergessenen Schriftsteller Polens. Gary kannte die Gegend um Vilnius gut, dort war er 1914 als Sohn aschkenasischer Juden als Roman Kacew zur Welt gekommen und 1928 mit seiner Mutter nach Frankreich geflüchtet.
„Wie weit das alles zurücklag: die Universität, die Prüfungen, das Studium, mit dem sie sich damals beschäftigt hatten, eine andere Welt war das, eine Welt, die nun verschwunden, versunken, verloren war. Aber in ihrem Unterstand lagen überall Bücherstapel, und Janek war beeindruckt, als er sah, wie sie trotz allem stundenlang über ihren Geschichtsbüchern und den Lehrbüchern der Rechtswissenschaft brüteten.“
Dass diese jungen Menschen durch das Leben und Sterben in den Wäldern beschädigt werden und sich verhärten, ist keine Frage, sondern zwangsläufig; der Geschichtsstudent Tadek Chmura ist Exponent dieses Zynismus, der von Verzweiflung geprägt ist.
„Die Menschen erzählen einander nette Geschichten und lassen sich dafür umbringen - sie glauben, dass der Mythos dadurch wahr wird. Freiheit, Würde, Brüderlichkeit, die Ehre, ein Mensch zu sein. Auch wir in diesem Wald lassen uns für ein Ammenmärchen töten.“
In der Auseinandersetzung mit seinem Vater, einem Gutsherren, der ihn vor dem sicheren Tod durch Tuberkulose retten will, wird auch eine andere Position deutlich, die im damaligen Polen nicht auf Terroraktionen und Sabotage setzte. „Die polnischen Bauern sind auf meiner Seite, nicht auf deiner. Was habt ihr für sie getan? Gar nichts. Dank eurer Meisterleistung hat man sie an die Wand gestellt, ihre Ernte beschlagnahmt und ihre Dörfer niedergebrannt. Das bisschen, was ihnen an Weizen und Kartoffeln geblieben ist, steht nicht euch zu, sondern mir. Ich habe nämlich keine Brücken in die Luft gejagt.“ Versöhnung ist da ausgeschlossen, und der Sohn Tadek nimmt lieber den Tod in Kauf.
In Siegerpose
Eine der vielen aufschlussreichen Begebenheiten, die Gary so kunstvoll ineinanderfügt, ist die des jüdischen Kindes Moniek Stern, das, obwohl völlig verelendet, Geige spielt. Janek tauscht es gegen einen Sack Kartoffeln von einer der vielen Kinderbanden ein:
„…in seiner kleinen Hand verwandelte sich der Geigenbogen in einen Zauberstab. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt, in Siegerpose, ein stolzes Lächeln auf den Lippen, und er spielte. Die Welt war aus dem Chaos erlöst. Sie fand zu ihrer reinen, harmonischen Form zurück. Zuerst starb der Hass, nach den ersten Akkorden starben Hunger und Verachtung, alles Hässliche verschwand, wie dunkle Larven, die, vom Licht geblendet, sterben.“
Auch die Liebesgeschichte von Janek und Zosia, einem jungen Mädchen, das sich für deutsche Soldaten prostituiert, um die Partisanen mit Informationen zu versorgen, ist von großer Feinfühligkeit und Zartheit. Gary schrieb seinen ersten Roman 1943, als er selbst als Flieger in Afrika gegen die Deutschen kämpfte und wie viele alle Hoffnungen auf die Schlacht von Stalingrad setzte. Zosia muss die Abfahrtszeit von Lastwagen mit Sprengstoff für Stalingrad herausbekommen, damit die Gruppe sie zerstören kann. Ihr Körper selbst wird zum Schlachtfeld: „Sie spürte den eiskalten Untergrund im Rücken, die spürte die Nägel und die Fäuste, die sie malträtierten, und sie fühlte den Hass, den lieblose Männer in ihre Zärtlichkeiten legen. Sie hörte den Schrei der Krähen, das leise Fluchen der Männer, sie hörte den Wind. Sie sprach nicht. Sie weinte nicht. Es war wie Hunger, wie Kälte, es war wie Krieg.“
Romain Garys Roman verbindet Kriegsgräuel mit Idealen, Kultur in all ihren Ausprägungen mit Ideen über die Verständigung zwischen den Völkern, und er wollte den Menschen, die sich der richtigen, ehrenhaften Sache verschrieben haben, ein Denkmal setzen. Auch wenn Menschlichkeit weit entfernt war, blieb sie für ihn doch das einzige Ziel, das dem Kampf um Freiheit Sinn verleiht, - eine Position, die in unserer Zeit wieder erstaunlich diskussionswürdig ist.
„Ich will, dass nach dem Krieg,…die Menschen dieses Buch aufschlagen und entdecken, dass das Gute heil geblieben ist, sie sollen wissen, dass man uns wohl zwingen konnte, wie Tiere zu leben, aber dass man uns nicht zur Verzweiflung zwingen konnte.“
(Lore Kleinert)
Romain Gary, *1914 in Vilnius/Litauen, war französischer Schriftsteller, Übersetzer, Regisseur, Diplomat, ist 1980 in Paris gestorben
Romain Gary „Europäische Erziehung“
Roman, aus dem Französischen von Birgit Kirberg
Verlag Klaus Wagenbach 2025, 220 Seiten, 24 Euro
