Anja Kampmann
Die Wut ist ein heller Stern
„Wir können uns die Sterne selbst schenken, so hat Arthur es zu Anfang gesagt, und etwas in mir wollte ihm glauben…“ Artistin am Hochseil ist sie geworden, Hedda, das Arbeitermädchen, das davon träumte, dem Elend zu entkommen. In Arthurs berühmtem Varieté „Alkazar“ zeigt sie einen gefährlichen Tanz am Seil, über den Mäulern zweier Kaimane.
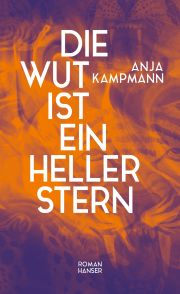 Vaters Schatten
Vaters Schatten
Vor der Machtübernahme der Nazis übte sie im Arbeitersportverein Fichte Altona, für den Frieden, wie es hieß, sah zum ersten Mal Artisten im Zirkus, hörte Caruso, „so eine Stimme, um die sich die ganze Welt dreht“, verliebte sich in das Boxtalent Kuddel und folgte der Sehnsucht nach einem anderen Leben.
„Zu Hause haust ein Schatten, der einmal unser Vater war…Mutters Husten, das diesige Licht, der Ofen, der nie mehr als lauwarm wurde. Dieses Leben, aus dem Arthur mich heraushob wie einen Fisch aus einem Bottich mit schmutzigem Wasser.“
Anja Kampmanns an der Lyrik geschulte Erzählstimme folgt Heddas Träumen, Erinnerungen und hellwachen Beobachtungen und macht die Erfahrungen in diesen Jahren, als das neue Regime tief in alle Lebensbereiche eindringt, schmerzhaft spürbar. Man muss wissen, dass der Hintergrund von Heddas Lebens in Hamburg real war: Arthur Wittkowskis „Alkazar“, das die neuen Machthaber sich Zug um Zug zu eigen machten und 1936 in ‚Allotria‘ umbenannten, der Widerstand der Hafen- und Werftarbeiter, der blutig zerschlagen wurde, das Elend der Menschen im Gängeviertel, schließlich die Gewalt, die alle traf, die nicht ins neue Zwangsbild passten.
Zerstörte Träume
Wie schon in ihrem ersten, preisgekrönten Roman „Wie hoch die Wasser steigen“ erzählt Kampmann virtuos von einem Menschen am Rand der Gesellschaft: den verzweifelten Versuchen der jungen Frau, nicht zu zerbrechen, bis zum Ruin all ihrer Träume. Jahr um Jahr bis zum Krieg kommt sie ihr auf poetische Weise berührend nah. Pauli, der kleine autistische Bruder mit von Rachitis verkrümmten Beinen hält sie in Hamburg zurück, denn ohne sie wäre er längst verloren:
“Träumen wollen, abends spät, nach allem, was war, im hinteren Teil der Schute auf dem Stroh liegen, und die Welt wird wieder ganz, hat eine Richtung, irgendwo ist dieses Helle, Große, worauf sich zuhalten lässt, jeden Morgen sucht er nach der Sonne, Pauli, als wäre sie alles, was zählt. Ich träume von ihm, wenn wir nachts auf dem Fluss sind.“
Ihr Geliebter wird im Zuchthaus ermordet, der ‚Graue‘, ein reicher älterer Mann mit Vergangenheit in den Kolonien, hält sie für sexuelle Dienste aus, und sie plündert die Laudanum-Vorräte seiner verstorbenen Frau, um den Schmerz zu ertragen.
„Ich erwarte nichts vom Grauen, hoffe auf nichts. Er ist nicht anders als die Töne, die er spielt, nichts kommt von ihm, nicht mal seine Lust – er braucht mich nur, um sich von sich selbst fernzuhalten.“
Ohne Zukunft
Hellsichtig bleibt sie, obwohl sie immer weiter in die Verzweiflung driftet und sich aufspaltet, sich immer wieder in ihre Ersatzidentität Rita flüchtet, die scheinbar glatt und selbstsicher bleibt und keinen Schmerz empfindet. Auch die Hoffnung auf den Bruder Jaan hält sie aufrecht: Als Harpunenschmied heuert er auf einem Walfänger an, und mit seinem Verdienst könnten Pauli und sie fliehen. Kampmann beschreibt mit Akribie, was der immer engere werdende Raum in der Diktatur bewirkt. Sie findet dafür eine reiche Sprache der Empathie, die nichts verschweigt oder beschönigt und die innere Leere infolge des Verlusts der Zukunft ernst nimmt.
„Ein leerer Ring auf deiner Bühne, Arthur. Warum rede ich so? Weil etwas sich aufzulösen begann, weil ich durch Glas auf meine Welt sehe, als wäre ich schon auf der anderen Seite?...Ich reite durch die Luft, ein eigener Rhythmus, Klang, damit ich ihr Stampfen nicht höre, ihre Sprechchöre, ihr Marschieren. Es klingt wie dumpfe Schläge, die durch Mauern dringen.“
Die Schläge kommen näher, der Schutz, den das ‚Alkazar‘ mit seinen ungewöhnlichen Menschen geboten hat, löst sich auf, sein Besitzer wird in der Presse geschmäht und in den Dreck gezogen, bis er nicht mehr kann, - ein grelles, treffendes Bild für ein Regime, das bis in die letzten Schlupfwinkel dringt: wo einmal Zukunft war, scheint jetzt die „schwarze Sonne“.
„Arthur zahlt, mit unserem Schweiß, alles Geld, das er einspielt, unsere Lust, unser Lachen, die langen Nächte, unsere Scham, er soll zahlen, aber der Drache sperrt seinen Rachen nur noch weiter auf.“
Verlorene Hoffnungen
In ihrer Sprache nimmt die Ich-Erzählerin die mögliche Selbstauslöschung vorweg, indem sie immer wieder beklagt, es gebe sie selbst nicht mehr, ein Loch in der Wand,
„angeschlagen wie die billigen Eier, die wir im Dutzend nehmen, damit wir einmal satt sind, wie zerbrechlich wir sind“.
Kampmann zeichnet die ebenso tapferen wie hilflosen Versuche nach, sich trotz allem zu wehren, sich aufrecht zu halten, sich auch im Kleinen zu behaupten. Sie geht dabei weit hinaus über die gängigen Klischees, die Widerstand und aufrechten Gang zu Bollwerken des Anstands verklären, leicht und per Entscheidung zu haben, und ihre prekäre Widersprüchlichkeit leugnen. Bis zum Ende bleibt Hedda/Rita die feinnervige Chronistin kaum zu ertragender Verluste in einem ohnehin armen Leben, in dem sie alles, was sie hatte, erkämpfen musste und sich am Ende nur noch an verlorene Hoffnungen halten kann. Ein eindringlicher, großartiger Roman über die Anfänge und das Weiterwirken einer großen Niederlage, und was sie schließlich mit Menschen macht.
„Denn nur ich bin hier. Höre, sehe. Maks, wie soll man von alldem erzählen, wie soll man auskommen ohne den seidigen Glanz der Nacht?“
(Lore Kleinert)
Anja Kampmann, *1983 in Hamburg, Autorin von Romanen und Lyrik, mehrfach für ihre Lyrik und Prosa ausgezeichnet, lebt in Leipzig
Anja Kampmann „Die Wut ist ein heller Stern“
Roman, Hanser Verlag 2025, 495 Seiten, 28 Euro
eBook 19,99 Euro
