Karl Schlögel
Der Duft der Imperien - Chanel No 5 und Rotes Moskau
"Das 'Jahrhundert der Extreme' hat seine eigenen Geruchslandschaften hervorgebracht. Revolutionen, Kriege, Bürgerkriege sind auch olfaktorische Ereignisse."
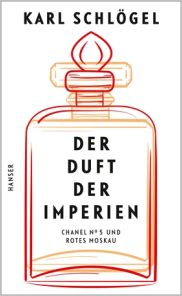 Siegeszug der Düfte
Siegeszug der Düfte
Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel wurde zu dieser Kulturgeschichte durch eigene Geruchserfahrungen inspiriert, begegnete er doch in Moskau und später der DDR bei festlichen Anlässen einem besonderen, charakteristischen Duft, dem damals populärsten Damenparfüm namens "Krasnaja Moskwa", dem 'Roten Moskau'. Er folgte seiner Nase und fand heraus, dass es schon vor der Revolution von der französischen Firma Brocard kreiert wurde, zum 300. Jubiläum der Romanows. Der Parfumeur Ernest Beaux transformierte es nach seiner Flucht vor der Revolution aus dem Lieblingsbouquet der Kaiserin Katharina II. in seinem Labor in Grasse zum berühmten Chanel N° 5, während sein Landsmann Auguste Michel, ein “aus der Welt von gestern herausgefallener bürgerlicher Experte“, in der Sowjetunion blieb.
Zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution, als die Parfumkultur nach harten Aufbaujahren rehabilitiert war, entwickelte er zur Freude der Sowjetbürgerinnen schließlich aus demselben, wieder aufgefundenen Grundstoff "Krasnaja Moskwa". Im Rahmen eines staatlichen sowjetischen Trusts mit dem Namen TeShe trat das Parfum, dessen elegante, moderne Flakons denen der westlichen Länder in nichts nachstanden, seinen Siegeszug an.
Ein neues Lebensgefühl
Schlögel erzählt anhand der beiden Parfums höchst inspirierend, wie weit sich die Sowjetunion von Westeuropa entfernt sah, und welche subkutanen Verbindungen, über die Zeit hinweg dennoch weiter existierten, obwohl sie sich "vom Geruch der sterbenden Klassen" befreien wollte. Diese unterirdischen, unbewussten Beziehungen in der Kunst, der Mode und der Luxusproduktion legt er mit großem Gespür für Details frei, mit Dichtern, die den erinnerten Duft zu Wort kommen lassen, als "Kronzeugen für die prägende Kraft, ja für die Evidenz der Geruchserfahrung", denn die Düfte selbst lassen sich nicht lange konservieren. Den Weg der Parfumeure verfolgt er dabei ebenso kundig und unterhaltsam wie den der beiden Frauen, die das neue Lebensgefühl perfekt verkörperten. Beaux wurde während der deutschen Okkupation Zwangsarbeiter in München und nahm nach dem Krieg seine Arbeit bei Chanel wieder auf, während sich Auguste Michels Spur in der Zeit der großen, stalinistischen Säuberungen verliert.
Die eigenen Ziele im Blick
Besonders anschaulich entfaltet sich die Geschichte anhand der beiden Schlüsselfiguren, Coco Chanel und Polina Shemtschushina-Molotowa: Sie gehörten komplett unterschiedlichen Welten an, doch ihre Herkunft aus kleinen Verhältnissen und der unbedingte Wille, etwas aus ihrem Leben zu machen, verbindet sie:
"selbstständig, selbstbewusst, energisch die eigenen Ziele verfolgend und ohne Rücksicht auf mögliche Opfer, die am Wegesrand zurückbleiben. Sie stecken zeitweilige Niederlagen mit Leichtigkeit weg, sie kommen in Form und achten auf ihre Form",
die eine als Selfmadewoman, die andere als Funktionärin und Chefin der sowjetischen Kosmetikindustrie, die dem 'Roten Moskau' zum Durchbruch verhalf. Shemtschushina hatte sich den Bolschewiki angeschlossen, als deren Sieg noch nicht feststand. Als erste und einzige Frau wurde sie Volkskommissarin, ein großes Organisationstalent, war auch als Gattin des späteren Außenministers Molotow weltläufig, bis sie im Zuge der Stalinschen Säuberungen entmachtet und verbannt wurde. Sie war "eine exemplarische Verkörperung des sozialen Aufstiegs durch die Revolution" und blieb auch nach ihrer Freilassung verbissene Stalinistin.
Comeback in den 50er Jahren
Der Zusammenhang zwischen der Welt der Düfte und der Aura der Macht wird elegant und immer in Rückbezug auf die jeweiligen politischen Verhältnisse entfaltet – Coco Chanel etwa nutzte ihre Chance, den jüdischen Eigentümern unter der deutschen Besatzung die Verwertungsrechte an ihrem Chanel N° 5 abzujagen. Dem berechtigten Vorwurf der Kollaboration entzog sie sich geschickt und feierte in den fünfziger Jahren ihr Comeback. Der Rauch der Krematorien und der Gestank der Lager dürfen in dieser reichhaltigen Kulturgeschichte nicht fehlen. Wie der russische Dichter Warlam Schalamow, der 17 Jahre in Lagern wie der Kolyma verbrachte, bezeugt, gipfelte die Abstumpfung aller menschlichen Gefühle in der Folter durch den geschärften Geruchssinn:
"Die Folter durch unerreichbares Brot verwandelt sich in eine Folter durch seinen Geruch. Dieser süße Geruch des Lebens wird zu einer der bedrückendsten Geruchsdominanten der Kolyma."
Auch Parfüms, und Karl Schlögels kluge Untersuchung kreist um diese Einsicht, können sich aus dem Gewalt- und Verführungszusammenhang ihrer Epoche nicht heraushalten. Während in den Neunziger Jahren die internationalen Parfums auch den russischen Markt eroberten, macht Schlögel dennoch auch Suchbewegungen nach den Spuren und Relikten der untergegangenen Welt aus. "Krasnaja Moskwa" erlebt ein Remake, und im Museum of Modern Arts gehört es neben Chanel N° 5.
(Lore Kleinert)
Karl Schlögel, *1948 in Bayern, emeritierter Professor für Osteuropäische Geschichte, lebt in Berlin
Karl Schlögel "Der Duft der Imperien"
Chanel No 5 und Rotes Moskau
Hanser Verlag 2020, 224 Seiten, 23 Euro
eBook 16,99 Euro
