Christoph Peters
Dorfroman
Hülkendonck ist ein fiktives Dorf am Niederrhein, ganz in der Nähe von Kalkar. Hier ist der Ich-Erzähler geboren, hat seine Jugend verbracht, hier leben im eigenen Haus noch immer seine Eltern, alt geworden, gebrechlich.
Atomenergie 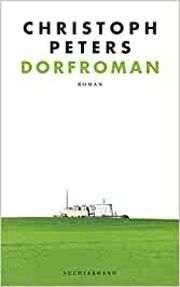 als Zukunft
als Zukunft
Er erinnert sich an seine Heimat, das geruhsame Dorf, den regelmäßigen Kirchgang als Christenpflicht, den strengen Katholizismus, die Vorbehalte gegen Protestanten und "Mischehen". 1970 kandidiert der Vater für den Kirchenvorstand, ein Gremium mit politischer Verantwortung. Das bald eine Rolle spielen wird, denn Anfang der 1970er Jahre flimmerte über die Fernsehbildschirme eine zukunftsweisende Nachricht:
"Brutreaktoren sind ein wichtiger Schritt hin zu einer langfristigen und preisgünstigen Stromversorgung. Mithilfe der Brutreaktoren kann die Energieerzeugung aus den vorhandenen Uranvorkommen vervielfacht werden, da diese Reaktoren den in den bisherigen Kernreaktoren nicht spaltbaren Teil des Urans in spaltbares Plutonium umwandeln."
Der "Schnelle Brüter" soll in Kalkar gebaut werden, nach Politikeraussagen der ideale Standort. Nicht alle in Hülkendonck sind von der Idee begeistert, auch wenn sie jede Menge Arbeitsplätze und den wirtschaftlichen Aufschwung der gesamten Region verspricht.
Jahre des Widerstands
Es sind die 1970er Jahre, in denen Wirtschaftswachstum und Fortschrittsglaube der Politik auf den zunehmenden Widerstand junger Menschen stößt, die in der neuen Technologie eine unkontrollierbare Bedrohung von Mensch und Umwelt sehen, die Anti-Atomkraft-Bewegung bekommt immer mehr Zulauf. Eine Gruppe von AKW-Gegnern darf sich im ehemaligen Melkstall eines Großbauern in Hülkendonck ein Camp aufbauen:
"Alle in Hülkendonck hassten diese Leute, die aus fremden Großstädten kamen, manche angeblich sogar aus Holland, sich um kein Gesetz scherten, Drogen nahmen und wild zusammen schliefen – jeder mit jedem-, ohne verheiratet zu sein. ... Wenn ihnen irgendetwas nicht in den Kram passte, bauten sie Barrikaden, zündeten Reifen an, warfen Steine und Molotow-Cocktails. Macht kaputt was Euch kaputt macht!, stand auf ihren Transparenten."
Ganz so schlimm geht es auf dem Camp nicht zu, aber die Neugier treibt den Erzähler unter dem Vorwand, Schmetterlinge zu fangen, immer wieder in die Nähe der bunten Gemeinschaft. Hier trifft er Juliane, sechs Jahre älter als er, mit 18 abgehauen von zuhause, abgetaucht ins anarchische Milieu, in die "allumfassende positive Energie im Universum" zu Beginn des viel besungenen Zeitalters des Wassermanns. Juliane ist seine erste große Liebe.
Wachsende Protestbewegung
In diesem Spannungsfeld erzählt Christoph Peters seine Geschichte, gräbt Erinnerungen und Gefühle aus, zeichnet das Porträt eines spießigen, katholischen Dorfes ebenso, wie er zurückblickt auf die bewegte Geschichte der Bundesrepublik in den 1970er und 1980er Jahren, als sich der Widerstand gegen Atomkraft, Umweltzerstörung und am schnellen Profit interessierte Großindustrie zu einer massiven Protestbewegung entwickelte. Widerstand gegen und Zustimmung zum Bau des "Schnellen Brüters" spalten die Dorfgemeinschaft, der Vater des Erzählers steht für die Befürworter-Fraktion, der Großbauer, bei dem die AKW-Gegner wohnen, vertritt die Gegner. Das kleine Dorf spiegelt in seiner Zerstrittenheit im kleinen die zunehmend hitzige Stimmung in der Bundesrepublik. Es ist die Zeit wirkungsvoller Parolen: "Wir sind die Leute, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben!"
Der Erzähler selbst, inzwischen längst Sympathisant der Kernkraftgegner und Naturbewahrer, läßt sich die Haare wachsen, die Streitereien mit den Eltern nehmen zu, er nabelt sich ab, befreit sich vom schützenden Kokon des einst friedlichen Dorfes, das selbst in die Schusslinien von Politik und Wirtschaft geraten ist. Die - auch erzählerisch - zunehmende Spannung eskaliert schließlich und entlädt sich in der ersten großen Demonstration gegen den "Schnellen Brüter." Zu den verletzten DemonstrantInnen gehört auch Juliane.
Freizeitpark statt Kernkraftwerk
Eine genaue und sorgfältige Spurensuche in der Kindheit, autofiktional, ein angesichts der damaligen gesellschaftlichen Umbrüche unaufgeregt erzählter Roman, der keine wirklichen Helden kennt, aber auch keine echten Verlierer. Peters blickt als erwachsener Mann, der seine Eltern besucht, nachdenklich und durchaus wehmütig zurück auf seine Heimat, schlüpft auf einer zweiten Ebene noch einmal hinein in die Rolle des jungen aufmüpfigen Sohnes, der sein Leben irgendwann selbst in die Hand nehmen und sich von niemandem reinreden lassen will.
"Ich wollte schon lange richtig für Tier- und Umweltschutz kämpfen – für die Rettung der Welt - und eigentlich war mir auch längst klar, dass ich Kernkraftwerke ablehnen musste ... Auch an der Liebe konnte ich nichts Schlimmes finden, egal ob man verheiratet war oder nicht."
Der Schnelle Brüter, Symbol der AKW-Bewegung in der Bundesrepublik, wurde eine der größten Investitionsruinen Deutschlands. 1985 fertiggestellt, ging er nie ans Netz. Heute ist das Gelände ein Freizeitpark.
(Christiane Schwalbe)
Christoph Peters, *1966 in Kalkar, vielfach ausgezeichneter Autor zahlreicher Romane und Erzählungen, lebt in Berlin
Christoph Peters "Dorfroman"
Luchterhand 2020, 416 Seiten, 22 Euro
eBook 17,99 Euro
Weitere Buchtipps zu Christoph Peters
"Diese wunderbare Bitterkeit" Leben mit Tee
"Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln"
